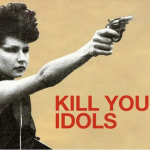Debatte um Führung
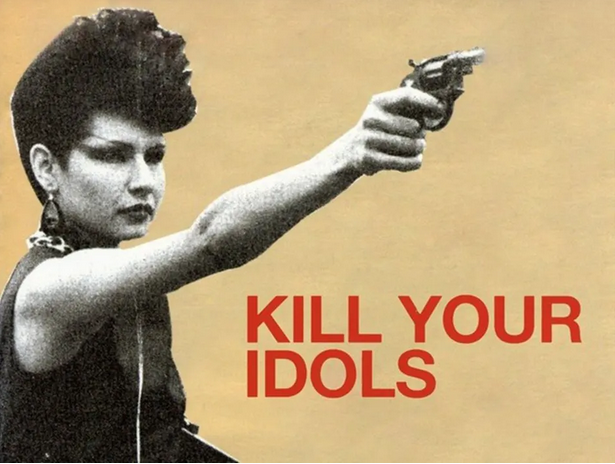
Hier kommt ein Beitrag zum Thema „Führung“. Er ist eine Reaktion auf Erzählungen vom Kollapscamp und die Forderung nach Führung durch einige Organisator*innen des Camps.
Damit soll nicht in Frage gestellt werden, dass das Camp sicher gut und sinnvoll war, noch den Beteiligten ihr Engagement abgesprochen werden. Die folgende Text ist polemisch, aber von einer ehrlichen Wertschätzung motiviert, die allen Menschen gilt, welche sich sichtbar oder unsichtbar, langanhaltend oder eher punktuell, lokal oder transnational und in welchen Themenbereichen auch immer engagieren.
GEDANKEN ZUM THEMA FÜHRUNG … (Teil 1)
In vier Teilen will ich mich dem Thema Führung widmen, das auf dem Kollapscamp aufgekommen ist und nun im Nachhinein von den Organisator*innen gesetzt wird. Im Wesentlichen wollen sie das Paradigma der Hierarchiearmut und den Anspruch des Hierarchieabbaus in linken Bewegungen auflösen.
Die Argumentation beruht dabei – wie häufig bei Kadern – auf angeblicher Effektivität, fehlender Wertschätzung für Verantwortungsübernahme, den von einer zunehmend autoritären Gesellschaft gesetzten Erfordernissen an den Kampf und damit auf einem Primat des Politischen. Scully beschreibt diese Position im Text „The Tyranny of Leaderlessness“ [https://steady.page/en/disrupt/posts/3f4ac939-b805-431d-93e7-b8ff498f4242] und verlängert damit den Führungsanspruch Tadzio Müllers. Doch weil meine Gedanken dazu etwas ausgeufert sind, setze ich mich erst im dritten und vierten Teil mit diesem Text auseinander und formuliere hier vorab einige allgemeinere Gedanken.
Offenbar kam es beim Kollapscamp zu einem größeren Missverständnis. Während der Eröffnungszeremonie wurde der egozentrische, langjährige Klima-Aktivist Tadzio Müller in Szene gesetzt und beleuchtet, während es rundherum ganz finster war. Zudem hielt er seine Rede von einem erhöhten Platz und sollte offenbar dann „symbolisch“ das „Heft der Handlung an das Bewegungskollektiv“ weitergeben. Das Problem war aber: Er gibt es nicht weiter. Der Versuch der Dekonstruktion des Führers sollte tatsächlich auf perfide Weise seine Weihe zum Bischof der Kollapsbewegung werden.[1]
Denn wenn die ganze Debatte um „Leadership“ von Herrn Müller von vorne herein mit geplant war, kann es nicht gelingen, sie offen zu führen. Zwar mag er nach Orientierung suchende Anhänger*innen finden und Genoss*innen, die seine Aktivitäten schätzen und ebenso wie er nach der vielbeschworenen Handlungsfähigkeit sozialer Bewegungen suchen. Mit ihrer Thematisierung von „Leadership“ treffen sie und er auch wichtige Punkte, die in berechtigter Unzufriedenheit gründen, wie es hier und da in ihren linken Bewegungen gelaufen ist.
Zum Beispiel kann es einen zur Verzweiflung bringen, wenn man sieht, wie linke Gruppen entstehen und fallen, deren Aktivitäten kommen und gehen. Wenn Menschen sich aufgrund ihrer Erfahrungen und Kompetenzen in Kontexten linker Bewegung schämen und sie daher nicht produktiv in Gruppen einbringen können, ist dies ein herber Verlust. Wenn in unstrukturierten Debatten Dinge nicht systematisch angegangen werden und es scheinbar eher darum geht, sich selbst zu bearbeiten, eine gute Zeit zu haben und sich weniger verzweifelt zu führen – dann ist das eine Verwechslung dessen, worum es in selbstorganisierten Gruppen geht. Und schließlich ist es äußerst problematisch, wenn es in selbsterklärten „hierarchielosen“ Gruppen informelle Hierarchien gibt, die oft viel intransparenter, weniger sachlich kritisierbar, verhandelbar und abrufbar sind.
Nur sind die Schlussfolgerungen, die man aus derartigen Beobachtungen und Erfahrungen zieht, offen. Und man muss nicht zu jenen gelangen, zu denen Tadzio und seine Fans kommen, sondern kann im Gegenteil aus guten Gründen auf die Ebene der Strukturen schauen, statt nun offensiv Führerschaft zu fordern. In „linken Szenen“, wie sie derzeit (noch) in der BRD bestehen fordern im Wesentlichen nur Menschen Führerschaft, die sich selbst als Führer*innen berufen sehen. „Berufen“ ist hier das richtige Wort, denn Führer – auch wie sie den Kollaps-Orga-Menschen vorschweben – werden nicht gewählt: sie berufen sich selbst. Denn darin liegt gerade ihre Souveränität, die im Bereich des Politischen ein Pendant zum Genie-Kult um einsame Intellektuelle oder Künstler*innen ist.
Im Übrigen ist es auch nicht so, dass im Anarchismus jede Form von Führerschaft – im Sinne von Autorität – abgelehnt wird. Michael Bakunin führt beispielsweise aus, dass „natürliche Autorität“ gerechtfertigt sein kann, wenn sie (a) sich an der Kompetenz in Hinblick auf das entsprechende Thema festmacht, (b) transparent zu Stande kommt, (c) abberufbar – und damit situationsbezogen – ist, (d) keine weiteren Privilegien ermöglicht. Die Autoritäts-Projektionen auf Nestor Machno, Buonnaventura Durruti, oder auch auf Errico Malatesta und Emma Goldman, verdeutlichen, dass auch unter jungen Anarch@s durchaus das Bedürfnis vorhanden ist, zu folgen. Und wer sich etwas in der Szene herumgetrieben hat, wird auch auf einzelne Gewerkschafts-Bosse, Steetfighter-Macker und paternalistische Antimilitaristen getroffen sein… Schaut man genauer hin, wird allerdings schnell deutlich, dass es hierbei eher um eine Vorbildfunktion geht, statt um eine tatsächliche Führung und Gefolgschaft.
Unter Anarchist*innen in der BRD wurde die Diskussion nach 2019 mit der Gründung der Plattform geführt. In deren Gründungsdokument Über die Bedingungen, unter denen wir kämpfen und den Zustand der anarchistischen Bewegung wird nach der Gegenwartsanalyse die anarchistische Bewegung im deutschsprachigen Raum betrachtet. Konstatiert werden Strategielosigkeit, Beliebigkeit und Profillosigkeit, Desorganisation, Unzuverlässigkeit, Falsch verstandene Autonomie, die Haltung zur Gesellschaft und zur Revolution, das Fehlen einer offenen, solidarischen Kritik untereinander sowie eine öffentliche Unsichtbarkeit und schlechte Außenwirkung. Nun ist an all diese anarchistischen „Tugenden“ zweifellos etwas dran. Sie betreffen übrigens nicht nur anarchistische Gruppen, sondern viele Zusammenhängen, in denen Verbindlichkeit und Machtverteilung, Ziele und Kompetenzen völlig unklar sind.
Schade ist es jedoch, wenn ein rein negativer Fokus auf die sogenannte Bewegung gesetzt wird, um sich selbst als die Lösung zu präsentieren. Immerhin hätten die Autor*innen sich auch Beispiele suchen können, wo die Organisation auf tatsächlich hierarchiearme und weitgehend gleichberechtigte Weise funktioniert. Bezeichnenderweise stellen diese sich selbst nur nicht so heraus, sondern arbeiten eher im Hintergrund – wie die meisten radikalen, effektiven und langfristig angelegten Projekte. Zumal der plattformistische Lösungsansatz, eine vermeintlich disziplinierte, kohärente, verbindliche Organisation hinzubekommen, nur bedingt funktioniert hat. Wenn sich Gruppen daran aufbauen konnten, dann meiner Ansicht nach nicht wegen, sondern trotz des plattformistischen Kader-Ansatzes. Meiner Wahrnehmung nach ist die Analyse richtig, aber verkürzt. Darum sind die Schlussfolgerungen inkonsequent und der Anarchismus wird mit einer Reduktion auf das Modell von Polit-Gruppen in seinen eigentlichen Möglichkeiten beschnitten.
[1] „Ein weiterer, und für uns sehr schmerzhafter Fehler, war die Art und Weise, wie die sehr aktiven Diskussionen, die wir in unserer Orga über die Rolle von “Leadership” führen, im Eröffnungsevent rüberkamen. Unsere Idee war, Tadzios sehr, und in der öffentlichen Sichtbarkeit auf jeden Fall zu zentrale Rolle bewusst zu thematisieren, und symbolisch die Übergabe des Hefts der Handlung an an das Bewegungskollektiv – eine Übergabe, die in der realen Arbeit bereits weitgehend passiert ist – darzustellen. Das kam ganz offensichtlich bei ganz vielen überhaupt nicht rüber, die leise Ironie konnte kaum jemand merken, und am Ende fanden selbst wir, dass es an manchen Punkten auch ziemlich cringe war“ (Statement „Genoss*innen“ / Kollapscamp).* * * * *
… DIE ZU MACHTRESSOURCEN, SOZIALEN ROLLEN UND AUFGABEN IN GRUPPEN FÜHREN (Teil 2)
Dabei werden in anarchistischen Zusammenhängen schon viel länger verschiedene Machtressourcen thematisiert und die Thematik differenzierter betrachtet.
Machtressourcen sind zum Beispiel (1) Kontakte zu Genoss*innen, (2) Kontakte zu Expert*innen, (3) Erfahrungen, (4) Wissen/Informationen, (5) Kraft zur Initiative, (6) Ausdauer im Engagement, (7) Diskussionsstärke (8) Theoriestärke, (9) Charisma, (10) Geld und Güter.
-> Gefragt werden muss also danach: Wer bringt welche Machtressourcen mit bzw. kann über sie verfügen? Wie können und wollen wir sie verteilen? Wie und zu welchem Grad können und wollen wir sie kollektivieren?
Es werden unterschiedliche soziale Rollen besprochen, die Menschen (meist aufgrund ihrer Sozialisation) einnehmen. Diese können zum Beispiel (archetypisch) benannt werden, als: (a) Organisator*in, b) Macher*in, (c) Unterstützer*in, (d) Sorgende*r, (e) Vermittler*in, (f) Skeptiker*in, (g) Agitator*in, (h) Chaot*in, (i) Erzähler*in, (j) Theoretiker*in oder eben auch (k) Kader*in.
-> Hierbei kann gefragt werden: Aus welchen Gründen tendieren wir jeweils zur Übernahme von bestimmten Rollen? Wann fühlen wir uns wohl und sinnvoll dabei und wann nicht? Können und möchten wir die Rollen wechseln? Gelingt es uns, uns in jeweils andere Rollen hineinzuversetzen?
Schließlich gibt es Aufgaben, die es in der jeweiligen Gruppe zu tun gibt. Diese variieren verständlicherweise je nach Gruppe und Situation. Grundsätzlich wäre es gut, wenn sie jeweils von mehr als einer Person übernommen und mit allen transparent rückgesprochen werden. Fast nie werden alle der folgenden Aufgaben vergeben, gelegentlich wechseln Verantwortlichkeiten, selten werden sie klar definiert, häufig werden Aufgaben jenen zugeschoben, die sie schon immer gemacht haben. Diese Aufgaben können beispielsweise benannt werden mit: (α) Rahmenbedingungen schaffen [„facilitator“], (β) Organisation der Gruppenstruktur und Arbeitsweise, (γ) Ressourcenbeschaffung, (δ) Kommunikation mit anderen Gruppen [„spokes person“], (ε) Zielfindung und Prozessbegleitung, (ζ) sozialer Zusammenhalt [„vibe watch“], (η) Springer*in, (θ) Sprecher*in [„spokes person], (ι) schwierige Situationen durch schnelle Entscheidungen auflösen [„quick decision facilitator“].
-> In Bezug auf Aufgaben kann beispielsweise gefragt werden: Wem trauen wir warum welche Aufgaben zu und wem nicht? Wie können wir Fähigkeiten und Kompetenzen wertschätzen? Wie können wir Fähigkeiten und Kompetenzen miteinander teilen und voneinander lernen? Welche Aufgaben sind (noch) funktional für unsere Ziele? Welche Aufgaben werden selten übernommen, kaum wertgeschätzt – und warum ist das so?
Wenn Menschen reflektiert, mit den Ressourcen, über die sie verfügen, aufgrund ihrer sozialen Rolle eine bestimmte Aufgabe übernehmen, erfüllen sie damit eine Funktion. Idealerweise kann dies völlig konsensual, gleichberechtigt und reflektiert geschehen. In der Realität ist dieser Anspruch des Hierarchieabbaus aus mehreren Gründen eine ziemliche Herausforderung. Doch das macht ihn nicht schlechter. Im Gegenteil kann argumentiert werden, dass hierarchiearme und machtkritische Gruppen sogar wesentlich effektiver funktionieren können, als hierarchisch-geführte. Dies sind alte Einsichten. Es geht um die Verknüpfungen zwischen unterschiedlichen Menschen – denn zum einen sind die Gesellschaft und die Menschen in ihr unterschiedlich. Zum anderen, erwächst aus der Synthese dieser Vielfalt die Stärke von emanzipatorischen sozialen Bewegungen. Also ist die Herausforderung anzugehen: Wie können die Verfügung über Ressourcen, erlernte soziale Rollen, sowie die Aufgaben in Gruppen so verbunden werden, dass die Funktionen einer Gruppe den selbst gesetzten Zielen entsprechen?
Bei den oben erwähnten Machtressourcen, sozialen Rollen und Aufgaben handelt es sich um ein holzschnittartiges Schema. Die Realität ist deutlich komplexer. Dennoch wiederholen sich derartige Aspekte eines potenziell wunderbaren Ganzen. Insofern lohnt es sich, sich die Zeit zu nehmen, grundlegend darüber nachzudenken, wie Menschen sich warum organisieren. Dies ist allerdings keine rein sozial-technologische Frage. Sie ist ebenso eine Frage von Beziehungen zwischen den Beteiligten.
Tadzio und seine Gefolgschaft reduzieren das komplexe Thema der Organisation von Gruppen auf die Führerschaft als soziale Rolle, die sich Einzelne anmaßen. Kader-Leute tendieren dazu, sich Ressourcen anzueignen, statt sie zu teilen. Sie werten ihre sozialen Rollen auf und andere ab. Sie eignen sich die Aufgaben an, in welchen sie am ehesten Macht ausüben können. Möglicherweise ist dies tatsächlich ein sozialer Effekt, dem menschliche Tiere in Gruppen unterliegen und damit nicht „schlimm“ oder an sich problematisch. Umso mehr, gilt es diesem entgegen zu wirken.
* * * * *
DAS COMING-OUT DER KADER-PERSONEN … (Teil 3)
Wie im ersten und zweiten Teil ausgeführt, ist das Problem von Führung in „linken“ Gruppen komplex. Eigentlich steht dahinter die Frage danach, wie die Verfügung über Machtressourcen, sozialen Rollen und Aufgaben in Gruppen sinnvoll, freiwillig und den selbst gesetzten Zielen entsprechend abgeglichen werden können.
Kader-Personen wie Tadzio Müller, Scully oder viele andere wollen das Paradigma der Hierarchiearmut und den Anspruch des Hierarchieabbaus in linken Bewegungen auflösen. Dahinter stehen sehr klassische Argumente: Angeblich würden Gruppen ohne Führung nicht effektiv arbeiten, würde es an Wertschätzung für die Engagierten fehlen, wäre es erforderlich in einer immer autoritärer werdenden Gesellschaft Hierarchien zu etablieren und damit ein Primat des Politischen zu setzen…
Im Text „The Tyranny of Leaderlessness“ [https://steady.page/en/disrupt/posts/3f4ac939-b805-431d-93e7-b8ff498f4242] bezieht sich Scully erklärtermaßen auf den lesenswerten Text The Tyranny of Structurelessness (1970). Bereits im Titel kommt zum Ausdruck, dass Scully einem gravierenden Fehlschluss erliegt, indem sie „Führungslosigkeit“ mit „Strukturlosigkeit“ gleichsetzt. Ohne Führer*innen gäbe es demnach keine Struktur (die den Führer*innen passen würde). Die Schlussfolgerung, die Jo Freeman im Kontext der feministischen Bewegung der 70er Jahre zieht, ist nun gerade eine völlig andere: Die klare (demokratische) Strukturierung von Gruppen, ist die Voraussetzung für eine gleichberechtigte und freiwillige, verbindliche und effektive, wertschätzende und hierarchiearme Organisation, die emanzipatorische Ziele verfolgt.
Um die Verdichtung und Verstetigung von Macht (in selbstorganisierten Gruppen) bei einzelnen Führungspersonen zu verhindern, nennt Freeman folgenden Mechanismen: (1) die Delegation von Macht an Einzelne durch demokratische Prozeduren, (2) die Verantwortlichkeit in Machtpositionen und deren Kontrolle, (3) die Verteilung von Macht an so viele Personen wie möglich und sinnvoll, (4) die Rotation von Machtpositionen und Verantwortlichkeiten zwischen Einzelnen, (5) die Verteilung von Aufgaben nach vernünftigen Kriterien (statt Sympathien), (6) die kontinuierliche Weitergabe von Informationen an alle Beteiligten, (7) den gleichen Zugang zu allen Ressourcen, die die Gruppe braucht.
Freeman zieht also äußerst wichtige Schlussfolgerungen aus ihren Erfahrungen in unklaren, unverbindlichen, vermeintlich „hierarchiefreien“ Zusammenhängen, in denen permanent über Zugehörigkeit und Zielsetzungen gestritten wird, während Aufgaben und Wertschätzung intransparent geschehen. Und sicherlich gibt es weiterhin sehr viel in der Organisation von „linken“ Gruppen zu problematisieren und zu verbessern. Fairerweise muss man zugeben, dass es ziemlich schwierig ist, sich autonom selbst Regeln zu geben, Ziele zu vereinbaren, Zugehörigkeiten und Arbeitsabläufe zu klären usw.. Wie Freeman schreibt, kann es da schnell zu antiautoritären Reflexen kommen, die noch vor anarchistischen Konzepten von Autonomie, Selbstbestimmung und Selbstorganisation stehen. Ihre Forderung, mit verschiedenen Machtressourcen, sozialen Rollen und Aufgaben transparent, abrufbar, rotierend, kontrolliert etc. umzugehen, ist sehr wichtig. (Ob dies immer demokratisch geschehen muss oder sich hierbei auch andere Wege finden, wäre eine Diskussion, die an anderer Stelle geführt werden müsste.)
Die anarchistische Ansicht in Hinblick auf die Frage nach Führerschaft ist meiner Ansicht nach jedenfalls Folgende: In gut strukturierten, selbstorganisierten und emanzipatorischen Gruppen, werden Aspekte von Führerschaft auf bestimmte Machtressourcen (z.B. Kraft zur Initiative, Charisma oder Informationen), soziale Rollen (bspw. Organisator*in, Macher*in, Kader*in) und Aufgaben der Gruppe (v.a. Sprecher*in, schnelle Entscheidungen) reduziert. Führerschaft als Bestandteil eines hierarchischen Organisationsmodells wird damit faktisch aufgelöst.
Scully, Tadzio und andere vermeiden die Diskussion über eine sinnvolle, effektive Organisation selbstorganisierter und emanzipatorischer Gruppen, weil für sie das Ergebnis schon zuvor feststeht: Sie halten Führerschaft – und zwar ihre Führung – für besser. Sie rechtfertigen diese damit, dass nur so den Arschlöchern entgegen getreten werden könnte. In der Folge geschieht das Coming-Out der harten Kader-Personen, die sich nicht mehr schämen wollen, sich Macht anzueignen und sie auszuüben. Selbstverständlich haben sie dies bereits früher getan. Nur mussten sie sich dabei kontrollieren lassen, wurden skeptisch beäugt oder man folgte nur widerwillig ihren Weisungen.
Doch das wollen die Kader-Personen nicht mehr. Denn erkennt niemand, das sie in diesem falschen Spiel die eigentlichen Opfer sind? Sie haben sich heroisch aufgeopfert für die Ziele „der“ Bewegung! (Sicher nicht für ihr Ego, beziehungsweise um ihr Selbstwertgefühl und ihre Rollenidentität in einer Gesellschaftsform erhalten zu können, die auf Konkurrenz, Leistungsdenken, Patriarchat und Hierarchien beruht). Und wie dankt ihnen das die orientierungslose und unselbständige Gefolgschaft? In dem sie die Führer*innen beschämt und sich schlecht fühlen lässt! Das Coming-Out der harten Kader-Personen wurde im Grunde genommen bereits in der finalen Szene des Films „Team America“ (2004) auf den Punkt gebracht.[1]
* * *
[1] Bei Team America handelt es sich um einen geschmacklosen Film, der darum die Begründungen und Umsetzung der US-amerikanischen Militäreinsätze im mittleren Osten (Afghanistan- und Irakkrieg) auf zynische Weise kritisiert. Der Link [https://www.youtube.com/watch?v=O5I9rXshOSY&ab_channel=andreasebner] führt zur entsprechenden Abschluss-Szene. Auch wenn ich persönlich diese (hochgradig sexistische) Sprache nicht verwende, finde ich sie gerade die Übertreibung auf das Führungsproblem zutreffend. Als Text bilde ich nur die entsprechend adaptierte Version ab.„Denn die Wahrheit ist, das Team [Kollaps] für [die Aufrechterhaltung ihrer Aktivist*innen-Identität] kämpft. Sie sind genauso schlimm, wie die Feinde, die sie bekämpfen“. – „Nein, sind wir nicht! Wir sind [Führer*innen]! Wir sind rücksichtslos, arrogant, blöd und hart! Und die [Bewegungslinken] – sind [weichgespült]! Und [die Regierung / Großkonzerne / die Faschisten] ist ein Arschloch! [Bewegungslinke] mögen [Führer*innen] nicht, weil [Bewegungslinke] von [Führer*innen] [dominiert] werden. Aber die [Führer*innen] [gängeln] auch Arschlöcher. Arschlöcher, die auf Alles scheißen wollen. [Bewegungslinke] glauben vielleicht, sie können auf ihre Weise mit Arschlöchern umgehen, aber das einzige, was ein Arschloch [aufhalten] kann, ist ein [Führer] – mit Eiern. Das Problem mit den [Führer*innen] ist, dass sie manchmal einfach zu viel [dominieren]. Oder [Anweisungen geben], wenn es unangebracht ist. […] Und nur eine [Bewegungslinke] kann ihnen das klar machen. Aber manchmal, sind [Bewegungslinke] so voller Scheiße, dass sie selbst zu Arschlöchern werden. Denn [Bewegungslinke] sind nur zwei Finger breit vom Arschloch entfernt. Ich weiß nicht sehr viel, über diese total verrückte Welt. Aber eins weiß ich genau: Wenn ihr uns dieses Arschloch nicht [aufhalten] lasst, werden unsere [Führer*innen] und unsere [Bewegungslinken] – komplett vollgeschissen sein.“
* * * * *
… UND DIE SELBSTENTLARVUNG DER FÜHRER*INNEN (Teil 4)
Scully/Cindy Peter mag ja 10 Jahre aktiv in „der“ Bewegung „mit immer mal wieder auch sehr sichtbaren Rollen, wie aktuell beim Kollapscamp“ engagiert sein. Sie mag erfahren haben, das Menschen darin antiautoritären Reflexen nachgehen, die nicht konstruktiv, wertschätzend und zielführend sind.
Solche Erfahrungen habe ich ebenfalls gemacht. Meiner Einschätzung nach werden solche Reflexe und bisweilen sogar Angriffe am häufigsten und vehementesten von Personen hervorgebracht, die selbst die Führung übernehmen wollen. In der Regel steht dahinter eine tiefsitzende persönliche Kränkung, die meistens rein gar nichts mit der Gruppe, in der sie ihre Machtansprüche geltend machen wollen, zu tun hat.
Es ist scheiße, das erfahren zu müssen beziehungsweise festzustellen, dass sich diese Dynamik in linken Gruppen systematisch wiederholt. Dementsprechend fragt Scully sich verständlicherweise: „Wieso sollten Menschen Verantwortung übernehmen wollen, sich Aufgaben stellen, die sie herausfordern, wenn sie sehen, wie mit denen umgegangen wird, die das vor ihnen getan haben“. Darauf gibt es aber eine einfache Antwort: Wenn Menschen sich keine Führungsrollen anmaßen, sondern einzelne machtvolle Positionen und Aufgaben ihnen im demokratischen Gruppenprozess übertragen werden, gibt es kein Problem und niemand sollte scheiße mit ihnen umgehen.
Wer sich seines eigenen Selbstwerts, den eigenen Ressourcen, Fähigkeiten, sozialen Rollen und Aufgaben bewusst ist und damit (größtenteils) zufrieden ist, kann mit den gekränkten Kader-Personen umgehen. Entweder man arbeitet nicht mit ihnen zusammen, bis sie ihr Verhalten reflektieren und verändern. Dabei ist es sinnvoll, sie darin zu unterstützen. Oder dieses Verhalten ist nicht übermäßig ausgeprägt, so das es bearbeitet werden kann oder sogar in die Funktionsweise von selbstorganisierten emanzipatorischen Gruppen einbauen lässt.
Im Text von Scully ist von derartigen Reflexionen leider nichts zu lesen. Dies liegt nicht nur daran, das Führungspersonen ihre Aufgaben und Funktionen mit ihrer sozialen Rolle verwechseln. Sondern sie maßen sich die Führung aufgrund ihrer entwickelten Persönlichkeitsstruktur an, sind sich jener aber in Wirklichkeit ziemlich unsicher. Meiner Lesart wird das klar, wenn sie schreibt: „Ich halte es grundsätzlich für extrem wichtig, dass wir Menschen in leadership-Funktionen haben und ich will und werde es nicht zulassen, dass aufgezwungene Scham und ggf. persönliche Angriffe mich in meiner politischen Arbeit einschränken, weil ich Angst habe, von meinen eigenen Strukturen und Verbündeten angegriffen und ausgeschlossen zu werden.“ – Mit anderen Worten: das bürgerlich-weiße Individuum will sich nicht einschränken und kontrollieren lassen, kein Wissen teilen und Macht abgeben müssen. Es WILL es nicht! Doch warum nötigen Cindy und Tadzio uns ihre aus dem christlichen Patriarchat stammenden Schamgefühle, ihren Geltungsdrang und ihre Allmachtsphantasien auf?
Leider stellt sich Tadzio Müller als das beste Beispiel für problematische Führungspersonen selbst so heraus, das man dabei nur Fremdscham empfinden kann. Er kann offensichtlich nicht zwischen sich und der Bewegung unterscheiden. Für emanzipatorische soziale Bewegungen ist eine derartige Über-Identifikation von Einzelpersonen mit ihr aber höchst problematisch. Denn dies bedeutet letztendlich, dass engagierte Menschen sich abhängig vom willkürlichen, unberechenbaren und autoritären Verhalten Einzelner machen. Die Gefolgschaft wird damit dem Willen der Führung untergeordnet und dient als Handlanger des bereits gesetzten Plans. Die Erfahrung zeigt: Wer so denkt, kann für selbstorganisierte, emanzipatorische Bewegungen äußerst problematisch werden. Im schlimmsten Fall kippen die leaders um und rächen sich am Subjekt, das sich von ihnen nicht anführen lassen wollte.
Wir können hier noch mal einen Blick zurück auf die basisdemokratischen Mechanismen werfen, die Jo Freeman vorgeschlagen hat, um intransparente und explizite Führungsansprüche von Einzelnen ins Leere laufen zu lassen. Damit erscheinen mir Cindy Peter und Tadzio Müller nicht als geeignet, um dauerhaft machtvollen Positionen und Aufgaben auszuüben. Ganz ehrlich, ich würde keiner Person über den Weg trauen, die ihr Mindset aus dem Bereich des neoliberalen Managements entlehnt und glaubt: „Es sind leader, die die ausgetretenen Pfade verlassen, Ideen pushen und neue Wege und Türen öffnen, die wir alle dann benutzen (können)“. Als wenn Personen zur Führung geboren wären – während andere eben folgen würden. What the fuck?! Das Kollapsdenken scheint bei einigen bürgerlichen Individuen nun ihre Phantasien von archaischen Horden hervorzukehren. Wir sind alle von einer Gesellschaft geprägt, in der es viel zu viele schlechte Apokalypse-Filme gab…
Hin und wieder zeigen sich Menschen beeindruckt von der Initiative, dem Charisma, der scheinbaren Klarheit und dem Tatendrang selbsternannter Führungspersonen. Respekt für deren kontinuierliches Engagement, eine Wertschätzung ihres zuverlässigen Einsatzes und eine Würdigung ihrer Fähigkeiten sind sicherlich völlig okay. Doch ehrlichen Respekt, Wertschätzung und Würdigung sollten allen Beteiligten in emanzipatorischen sozialen Bewegungen für ihre jeweiligen Fähigkeiten, Tätigkeiten, Sichtweisen und Seinsweisen zukommen – auch und gerade, wenn sie dies nicht offensiv und krampfhaft einfordern.
Eine Kultur der gegenseitigen Respekt, Wertschätzung und Würdigung ist in vielen Fällen noch weiter zu entwickeln. Doch anmaßenden Führer*innen geht es um mehr: um die Aneignung von Macht und Ausübung von Macht durch sie als Personen. Wenn es heißt, sie würden ja so viel tun und reißen, sie hätten einen Plan – dann wird selten danach gefragt, wen sie zur Erreichung und Aufrechterhaltung ihrer Machtposition zur Seite gedrückt und vergrault haben… Dagegen braucht es kollektive Organisierung, mit der die individualisierte Überhöhung Einzelner gar nicht erst erstrebenswert erscheint und möglich wird.
Zusammengefasst: Viele Punkte, die in der Debatte um Führung angestoßen werden, sind berechtigt und wichtig. Die propagierte Führerschaft ist – zumindest aus anarchistischer Perspektive – aber ein absoluter Holzweg. Damit wird eine komplexe Debatte um die schwierige Organisation von selbstorganisierten emanzipatorischen Gruppen abgekürzt. Das Thema von verschieden verteilten Machtressourcen und Fähigkeiten und wie sie sinnvoll mit unterschiedlichen sozialen Rollen und Aufgaben verbunden werden können, wird umschifft. Stattdessen geschieht (zumindest im Hintergrund) eine Essentialisierung vermeintlicher Führer-Typen, ohne, dass jene ihre Privilegien reflektieren und Macht teilen müssten. Das Coming-Out der Kader-Personen wird die Arschlöcher nicht aufhalten. Sondern nur die freiwillige, kontinuierliche, verbindliche und zielgerichtete Organisation von Gruppen in emanzipatorischen sozialen Bewegungen. Darum lasst uns nicht verhärten.