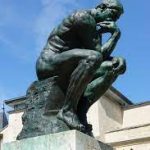Für ein Ende des idealistischen philosophisches Gewäschs. – Über einsame Philosophen und ihren überlebten Avantgardismus
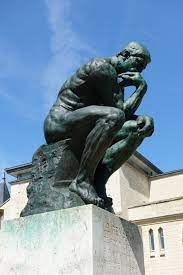
Am 23.03.2025 veröffentlichte Emanuel Kapfinger den Beitrag „Das Ende eines Bewegungszyklus. Über die Linke und einen neuen Anfang“ [https://knack.news/13452]. Dabei handelt es sich um einen der schlechtesten theoretischen und analytischen Texte, die ich seit langem gelesen habe. Würde der Autor mit seinen spekulativen Überlegungen alleine dastehen, wäre dies keines Kommentars wert. Leider beziehen sich jedoch einige „Linke“ auf derartiges philosophisches Gewäsch und verstricken sich in Debatten darum. Daher erscheint es mir sinnvoll, etwas der Annahme entgegenzusetzen, in diesen intellektuelle Gedankenwust wäre irgendetwas Wertvolles für Engagierte in emanzipatorischen sozialen Bewegungen vorhanden. Fast paradigmatisch bekommen wir in Beiträgen wie solchen die Selbstbezüglichkeit der allzudeutschen idealistischen Philosophie vorgeführt. Dies meine ich im beschreibenden Sinne, denn daraus könnte ja auch etwas Vernünftiges und Brauchbares erwachsen. Stattdessen entsteht bei mir aber der Eindruck, der einsame Philosoph würde uns Lesende vor allem ordentlich eins reinhegeln und mit seinen Geschwafel beeindrucken wollen.
Kritiken „ad hominem“ werden gemeinhin als nicht seriös verworfen. Damit gemeint ist die Diskreditierung von Personen, um sich mit deren eigentlichen Argumenten nicht auseinandersetzen zu müssen, die jedoch unabhängig vom Autoren Geltung haben können. Doch im vorliegenden Fall scheint es mir unbedingt erforderlich, auch einen Blick darauf zu werfen, wieso manche Intellektuelle derart irrelevante und selbstbezügliche Texte in gleichermaßen hochtrabenden Worten produzieren – und warum andere sich davon beeindrucken lassen. Denn dies sagt wiederum erstens etwas darüber aus, in welcher bestimmten Zeit und Gesellschaft wir leben. Zweitens erkennen wir dadurch besser, in welche Kontinuitäten wir intellektuelle Auseinandersetzungen stellen – und von welchen Stilen und Selbstverständnissen es sich vielleicht endlich zu lösen gelten, wenn Engagierte in emanzipatorischen sozialen Bewegungen theoretisch und strategisch wachsen wollen.
Der Text „Das Ende eines Bewegungszyklus“ strotzt vor Einsamkeit im Sinne einer unreflektiert-männlichen Beziehungslosigkeit. In ihm wird keine echte Auseinandersetzung mit Menschen dieser Gesellschaftsform formuliert, sondern lediglich eine um abstrakte Wahrnehmungen und Interpretation geführt. Damit verbunden ist weiterhin ein anachronistischer Avantgardismus, den solche einsamen Philosophen an den Tag legen. Sie rechtfertigen damit ihre eigene distanzierte pseudo-radikale Haltung, die sie mit einem klassischen Kult um verkannte Genies schmücken. Daraus folgt, dass die von ihnen kritisierten Akteure nie das tun, was sie den moralisch aufgeladenen Vorstellungen der pseudo-radikalen „genialen“ Philosophen tun sollten. Um sich jedoch weiter im Gespräch zu halten, gibt der Autor dennoch Ausblicke auf eine zwar verstellte, aber irgendwie durchschimmernde „revolutionäre“ Perspektive vermeintlich neuartiger Subjekte, die es richten sollen und die er anführen kann.
Kapfinger und Konsorten sind keine „organischen Intellektuellen“, die tatsächlich von der Realität emanzipatorischer sozialer Bewegungen und der gesellschaftlichen Verhältnisse – in denen jene sich formieren und agieren – ausgehen würden. Vielmehr sind sie Ausdruck eines selbstbezüglichen Intellektuellen-Milieus, das recht krampfig nach Bestätigung, Aufmerksamkeit und Aufgaben sucht. Bei dem Move, sich möglichst skeptisch gegenüber realen „linken“ Kräften zu zeigen, handelt es sich um eine wirklich langweile und ausgelutschte Verhaltensweise. In ihr kommt im Grunde genommen nur Trotz zum Ausdruck. Damit ist nicht das Anliegen verbunden, die eigenen Fähigkeiten für Organisierung, Bewusstseinsbildung und Auseinandersetzung tatsächlicher Menschen anzuwenden. Denn wäre es dies, würde es bedeuten, vom hohen Ross herabzusteigen, anderen als Genoss:innen zu begegnen, ihnen zuzuhören und in Widersprüchen nach Handlungsmöglichkeiten zu suchen.
Doch gehen wir die wesentlichen der vorgeblich geistreichen Aussagen des einsamen Philosophen genauer durch, um die Problematik etwas zu beleuchten:
Erstens. Der Ausgangspunkt des Textes besteht – wie schon die Überschrift beinhaltet – in der Behauptung, ein Zyklus sozialer Bewegungen seit 1968 sei zu Ende gekommen. Nun bräuchte es etwas ganz Neues, nach dessen Keimen der Autor sucht. Zunächst können wir recht froh sein, das verschiedene Dinge von 68 sich überlebt haben. Der Tomatenwurf auf Hans-Jürgen Krahl war etwa ein symbolischer Ausgangspunkt für die zweite Welle feministischer Bewegungen. Bei Krahl handelt es sich um einen mystifizierten Kritischen Theoretiker, der vermutlich gerade deswegen Bekanntheit erlangt hat, weil er mit 27 gestorben ist und sich somit zum Popstar idealisieren lässt. Dabei stellt sich der einsame Philosoph obsessiv in dessen männlich-„revolutionäre“ Tradition – und wäre somit eines eigenen Tomatenwurfs würdig. Auch die K-Gruppen der 70er und 80er Jahren sind bekanntlich wieder im Auftrieb begriffen. Die Geschichte wiederholt sich offenbar beim zweiten Mal als Farce und beim dritten Mal als Revisionismus – sowohl, was den autoritären Kommunismus, als auch patriarchale Avantgarde-Vorstellungen angeht…
Mit anderen Worten: Das sich gesellschaftliche Rahmenbedingungen und soziale Bewegungen im Laufe von fünf Jahrzehnten verändern und dabei eine wechselseitige Beeinflussung geschieht, ist eine extrem unspektakuläre Aussage. Um Gewinn aus einer historischen Betrachtung von „Bewegungszyklen“ zu ziehen, müsste dagegen nach Kontinuitäten und Veränderungen geschaut werden. Wie diese dann eingeschätzt werden, ist eine Frage des zeitlichen Maßstabs und der Perspektive.
Zweitens. Der einsame Philosoph fordert eine neue „revolutionäre Politik“, die „die Kritik und den Bruch mit der Linken, und in der Folge die Neugründung eines Milieus revolutionärer Intellektueller“ voraussetze. Dies bedeutet im Grunde genommen lediglich, dass der Autor vollkommen überkommenen Vorstellungen davon anhängt, was „revolutionär“ ist. Schlimmer noch, seine Vorstellungen entstehen nicht in Anschauung und Auseinandersetzung mit realen „linken“ Kräften, sondern anhand der Projektion seiner fetischisierten Revolutionsromantik. Im Hintergrund steht vor allem eines: Die angeblich „revolutionären Intellektuellen“ sind vor allem er und jene, die ähnlich arrogant wie er selbst auftreten. Dahinter liegt keine solidarische Grundhaltung, sondern im Wesentlichen Besserwisserei, die anderen den Gehalt ihrer Erfahrungen abspricht.
Drittens. Die Argumentation des Textes beruht auf vorausgesetzten Behauptungen, die daher schlecht hinterfragt werden können. Etwa jener das die Linke „heute als durch und durch positive Kategorie von fast universaler Reichweite“ gelten würde. Dies entspricht nicht den Tatsachen. Nehmen wir (unabhängig von irgendwelchen Wahlergebnissen) einmal an, dass sich ein Fünftel der Bevölkerung im dargestellten Sinne „links“ verortet, so wäre das schon optimistisch. Bekannterweise von antikommunistischer Propaganda, von Halbbildung und Ressentiments geprägt, kann eine „durch und durch positive“ Bezugnahme auf Linkssein heute unter Deutschen (aber auch Polen, Franzosen usw.) sicherlich nicht festgestellt werden. Ebenso falsch ist die Behauptung, das „Linkssein“ als „die“ politische Identität schlechthin gelten würde. Es gibt genauso renitente konservative, verfestigte neofaschistische oder staatstragend-grüne Milieus mit entsprechenden politischen Identitäten. Diese verorten sich in Abgrenzung zueinander – wie es politische Identitäten eben gemeinhin tun.
„Die“ gesellschaftliche Linke kann deswegen nicht für sich beanspruchen, generell für (progressive etc.) Projekte zur Gesellschaftstransformation zu stehen (wie Kapfinger fälschlich behauptet). Sie ist einfach eines der großen gesellschaftlich-politischen Lager unter sechs oder sieben. Wenn der Autor feststellt, dass erst Anfang der 1990er „das Linkssein zur allgemeinverständlichen Vokabel politischer Identität“ wurde, liegt dies an der absoluten Diskreditierung des Bezugspunktes „Sozialismus“ mit dem Niedergang jener Gesellschaftssysteme, deren Regierungen behaupteten, ihn zu verwirklichen. Sicherlich stimmt es, dass sich die sogenannte gesellschaftliche Linke seit der Regierungsbeteiligten der Grünen 1998 noch einmal neu (jenseits davon) formierte. Doch ist diese Feststellung ebenso wenig spektakulär, wie jene, dass auch die „radikale Linke“ Bestandteil der damit verbundenen Einhegung und Entradikalisierung der sie tragenden Milieus und Gruppen ist.
Viertens. Mit derartigen Aussagen kreiert der einsame Philosoph das Bild einer irgendwie „reinen“, „unverbrauchten“, „eigentlich radikalen“ Linken, welche es sie vor 2010, vor 1998, vor 1990 und tatsächlich nur um 1968 herum gegeben hätte. Geschichte wird für ihn scheinbar eher in singulären (und heroischen?) Ereignissen geschrieben, statt sie in komplexen und widersprüchlichen Prozessen zu begreifen. Die Pseudo-Radikalität des Autoren zeigt sich gerade in dieser historischen Konstruktion – und offenbart tatsächlich seinen eigenen Konservatismus, vor dessen Hintergrund er alle neueren Entwicklungen des ominösen Subjekts „gesellschaftliche Linke“ schlechtredet. Seiner Ansicht nach wäre jene „heute im Grunde lediglich noch ein Konglomerat von linken Institutionen bzw. linken Teilen von Staatsapparaten, und besteht im Wesentlichen aus Intellektuellen, die durch ihr Linkssein Geld verdienen. Nicht selten konnten diese auch ihre Herkunft aus den Bewegungen in bürgerliche Karrieren überführen“. Hierbei wird die unsolidarische Haltung des einsamen Philosophen deutlich, der engagierten Menschen pauschal abspricht, für ihre Überzeugungen und Werte einzutreten und sich damit einzumischen.
Weiterhin verkennt er die strukturellen Effekte von Bürokratisierung, Entradikalisierung und Einhegung, denen länger bestehende Organisationen gleich welcher Grundlagen generell unterliegen. Statt aber auf diese Effekte als kritische Anmerkung hinzuweisen, verurteilt er engagierte Personen auf plumpe moralistische Weise. Schließlich verschleiert der einsame Philosoph sein eigenes Bestreben und Begehren, dass ihm zu derartigen Ressentiments und Unterstellungen führt. Denn das er aus eben jenem Milieu entstammt, welches er so unlauter kritisiert, unterschlägt er geflissentlich. Er ist es doch, der von einer bürgerlichen Karriere als Professor träumt. Da sie ihm aufgrund seiner Arroganz verwehrt wird, bleibt ihm offenbar nur, sich als verkanntes Genie zu inszenieren. Wenn er schreibt, diese „institutionelle Linke reproduziert sich nicht in erster Linie politisch, sondern durch die Karriereinteressen linker Intellektueller“, drückt sich darin meines Erachtens nach nichts weiter als Neid aus. Darüber hinaus wird kein wesentlicher Unterschied deutlich zu den Effekten von Bürokratisierung, Entradikalisierung und Einhegung, wie sie auf sozialistische Organisationen ebenso in früheren Jahrzehnten wirkten.
Fünftens. Der einsame Philosoph stößt mit seiner pseudo-radikalen Forderung nach einer „revolutionären Politik“ (zweitens), die er einem auf historischer Konstruktion und Behauptungen beruhenden Subjekt (drittens) unterstellt, welches – im Gegensatz zu ihm – eingehegt, Karriere-orientiert, selbstbezüglich usw. wäre (viertens), auf einen Scheinwiderspruch. Dieser ist jener zwischen einer „revolutionären“ Bezugnahme auf eine emanzipatorische Utopie und der „Realpolitik“, die linke Organisationen anhand von staatlich-politischen Rahmenbedingungen praktizieren. Im Grunde genommen fehlt beides: die vom Autoren und ähnlich gesinnten philosophischen Linken fetischisierte „revolutionäre Bewegung“, wie auch die von ihnen idealisierte „Utopie“ einer „anderen Gesellschaft“.
Zurecht wird im Text daher auf die Kluft verwiesen, anhand derer etwa Politiker*innen der Linkspartei radikale Phrasen dreschen und im selben Zuge pragmatisch das langweilige politische Tagesgeschäft betreiben. Völlig falsch liegt der einsame Philosoph aber mit der Annahme, dass es sich hierbei um irgendetwas ansatzweise Neues handeln würde. Im Gegenteil wird darin nur Scheinwiderspruch der deutschen Sozialdemokratie reflektiert, wie er um 1900 herum im „Revisionismusstreit“ ausgetragen wurde. Darin vertrat auf der einen Seite Eduard Bernstein den „Revisionismus“, also die realpolitische Anpassung sozialdemokratischer Rhetorik und Zielbestimmung auf Partizipation im bürgerlich-parlamentarischem System (die auch den größten Teil ihrer Praxis ausmachte). Dagegen trat andererseits Karl Kautsky für den orthodoxen Marxismus ein, das heißt, er hielt eine revolutionäre Rhetorik und die Zielbestimmung auf eine kommunistische Gesellschaft aufrecht. Diese diente jedoch wiederum vor allem dazu, die eigenen Anhänger:innen zu motivieren und in der Konsequenz die gleiche reformistische Praxis zu verschleiern. Schließlich vertrat Rosa Luxemburg eine dritte Position, die sich stärker an sozialen Bewegungen orientierte und in den letzten Jahren als „radikale Realpolitik“ aufgewärmt wurde. Mit anderen Worten umkreist der Autor in seinen Überlegungen ein Problem, um welches vor 125 ausgiebig gestritten wurde – und bei dem es sich damit um reinste Folklore handelt.
Wie von seinen historischen Vorgängern werden von ihn dabei anarchistische Positionen einfach ignoriert, mit denen bereits damals darauf hingewiesen wurde, dass es sich bei der Entgegensetzung von „Reform“ und „Revolution“ um einen Scheinwiderspruch handelt, mit welchem die Logik, Prozesse und Institutionen staatlich orientierter Politik überhaupt nicht verlassen und aufgebrochen werden. Jene „revolutionäre Politik“, die dem einsamen Philosophen vorschwebt, offenbart sich damit als idealistisches Wunschdenken, dass dessen Pseudo-Radikalität und überlebten Avantgardismus nur schlecht verschleiert. Daher meckert der Autor: „Die Zustimmung der regierenden Linksparteien in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern zur imperialistischen Wiederaufrüstung Deutschlands stellt daher keinen Bruch dar, sondern zeigt lediglich die Sozialdemokratisierung der Linkspartei in aller Deutlichkeit“. Doch damit hat er uns nichts zu sagen. Sagen wir seit spätestens 1998 setzte die SPD zu ihrer Erneuerung und Machterhaltung eine neoliberale Agenda um. Gerade wer in den ostdeutschen Bundesländern Politik verfolgt weiß: Die Linkspartei ist die Sozialdemokratie in der BRD. Daran ändert sich auch nichts, wenn sie Kampagnen für Mietendeckel aufzieht, mit Haustürwahlkämpfen populär wird oder eine Pro-Palästina-Demo organisiert und sich damit selbst als Akteur jenseits des Parlamentarismus inszeniert. Diese kann und sollte man selbstverständlich kritisieren. Doch ist die populistische Inszenierung von Radikalität, Volks- oder Klassenbezogenheit oder Verbundenheit mit sozialen Bewegungen nichts „Falsches“ oder „moralisch Verwerfliches“. Es ist albern, dass linke Politik bei distanzierten Intellektuellen wie dem einsamen Philosophen für Enttäuschung sorgt und nun als Grund für seine Kränkung herhalten muss, obwohl dieser in Wirklichkeit in seiner idealistischen Metaphysik und/oder frühen Kindheit zu suchen ist.
Sechstens. Auch ein einsamer Philosoph sucht nach anderen, nach Beziehungen und nach Aufgaben. So stellt er beispielsweise fest: „Um angesichts dieser auf uns zurollenden Katastrophe agieren zu können, ist eine offensive revolutionäre Praxis nötig“. Hört, hört! Es wäre ja schön, wenn er sich an einer solchen beteiligen würde! Allerdings wird dabei aus Berlin nichts Neues mehr kommen. Denn seine Bezugspunkte bleiben vage intellektuelle Selbstbespiegelungen, wie sich leicht feststellen lässt, wenn er formuliert: „Heute stellt sich die Aufgabe einer Neugründung der revolutionären Bewegung. Dafür muss der Bruch mit der Linken vollzogen werden. Erste, noch unkoordinierte Schritte in diese Richtung entwickeln sich in einem derzeit neu entstehenden radikalen Milieu politischer Intellektueller, das beispielsweise in der Ausstellung ‚Illiberal Arts‘ [..] aus dem Jahr 2021 oder auf dem NON-Kongress vom Juni 2024 […] in Erscheinung getreten ist“. Na dann frohes Brechen, nach diesen kra(m)pfig Distanzierungsreflexen! Der Ansicht des Autoren hätte sich eine vermeintlich „neue Klasse auf globaler Stufenleiter entwickelt […], die sie mit Begriffen wie Surplus-Proletariat, Non-Bewegungen oder Identitätslose zu fassen“ versucht werde. Statt der eingehegten Arbeiter:innenklasse des 20. Jahrhunderts kehre in diesem Prekariat eher „das Proletariat des 19. Jahrhunderts wieder, wie es von Marx beschrieben wurde“. Es wären „absolute Randgruppen, die, wiewohl vom System produziert, nirgends eine Zugehörigkeit zu ihm beanspruchen können“, in denen nun das revolutionäre Potenzial zu suchen wäre. Wie der Genosse Verbreiter anmerkt, ist dem einsamen Philosophen hierbei zu widersprechen, zieht er daraus „genau die falsche Schlussfolgerung“. Nämlich jene, nun zum fünften Mal aufgewärmt, nach „dem“ neuen revolutionären Subjekt zu suchen, das avantgardistisch angeführt werden könnte und auf intellektuelle Beratung angewiesen sei. Doch was ist, wenn diese prekären, proletarisierten sozialen Klassen und Milieus unserer Zeit „non“ dazu sagen?
Das Proletariat des 19. Jahrhunderts wird nicht wiederkehren, ebenso, wie sich die Lebensbedingungen der heutigen Menschen verändert haben, der liberale Individualismus durchgesetzt und digitale Technologien die Rahmenbedingungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens massiv verändert haben. Darüber hinaus war das Proletariat nie so homogen, wie es vor allem die kommunistische Propaganda zeichnete, um Menschen für ihre Parteipolitik zu mobilisieren. Wenn einiges dafür spricht „dass diese [vermeintlich] neue Klasse, die nichts zu verlieren hat als ihre Ketten, sich künftig als zentrale Dimension der globalen Herrschaftstotalität geltend machen wird“, dann gäbe es ja christlich-idealistische „Hoffnung“. Wir könnten uns auf leidende Unterworfene beziehen, die es richten würden und auch einsame Philosophen mit befreien würden – auch wenn das Zerbrechen ihrer digitalen Ketten von Produktion, Propaganda und Überwachung wohl sehr schwierig wird. Avantgardistische Künstler:innen und Kritische Philosoph:innen könnten dazu eventuell beitragen. Wenn sie sich als Teil dessen begreifen würden was ist und aufhören würden, das Sein am Sollen zu messen. Das heißt, wenn sie sich als Teil emanzipatorischer sozialer Bewegungen begreifen, ihren eigenen Emanzipationsbedarf reflektieren und aus dieser Motivation heraus und mit diesem Bewusstsein ins Handeln gelangen würden. Von gewerkschaftlicher Organisierung, über Klimabewegung, antirassistischer Unterstützung, hin zu Antifa-Demos, Stadtteilarbeit oder queerem Feminismus gäbe es dabei genug zu tun.
Was folgt aus der hier ausgeführten Einschätzung des Textes „Das Ende eines Bewegungszyklus“? Ich habe erstens dargestellt, dass die Überlegungen des Autoren einer idealistischen deutschen Philosophie entspringen, die es zu problematisieren gilt, weil mit ihr die Wirklichkeit verkannt wird.
Zweitens habe ich auf die Beziehungslosigkeit des einsamen Philosophen hingewiesen, auch wenn dieser mir als Person egal ist. Von Intellektuellen, die Engagierten in emanzipatorischen sozialen Bewegungen tatsächlich etwas sagen könnten, sollte erwartet werden, dass sie mit ihrer eigenen Subjektivität reflektiert umgehen. Vor allem sollte man von ihnen eine solidarische Grundhaltung erwarten. Der einsame Philosoph produziert stattdessen eine selbsterfüllende Prophezeiung, indem er Menschen mit seiner Arroganz vergrault, von denen er sich dann krampfhaft distanzieren muss.
Drittens habe ich dargestellt, dass die Inszenierung des Autoren pseudo-radikal ist und eher seiner eigenen Verortung dient, als irgendwelche strategische oder theoretische Erkenntnisse zu liefern. Sein intellektuelles Geblubber erweist sich als heiße Luft. Doch diese wärmt noch nicht mal den Raum, wie die populistisch-humanistische Rhetorik der kritisierten Linksparteipolitiker:innen.
Daraus ergibt sich viertens, dass es nicht mit der vermeintlich reformistischen gesellschaftlichen Linken zu brechen gilt, die dem einsamen Philosoph selbst als Pappkamerad dient. Vielmehr sollten wir endlich den seit 100 Jahren überlebten, moralisch aufgeladenen Scheinwiderspruch zwischen „Reform“ und „Revolution“ hinter uns lassen. Dies gelänge allerdings nur mit einer grundlegenden Kritik der Politik. Wir sollten aufhören, Utopie als etwas „ganz anderes“ und als Totalität zu idealisieren, sondern sie konkret unter uns entdecken. Wir sollten schließlich aufhören, ständig irgendwo nach „revolutionären Subjekten“ zu suchen um sie avantgardistisch als Kanonenfutter in die Schlacht zu schicken.
Fünftens kann dem Autoren nichts anbieten, was ihm helfen könnte, um seine Beziehungslosigkeit zu überwinden. Teilweise, weil sie Produkt einer bestimmten Gesellschaftsform ist, die wir höchstens miteinander überwinden könnten. Zum Teil, weil dies voraussetzen würde, das er seinen eigenen Emanzipationsbedarf sieht und die von ihm selbstgewählte Rolle hinterfragt, statt sie arrogant zu rechtfertigen und in seiner unsolidarischen Selbstbezüglichkeit zu verharren. Alle anderen, die solche Texte lesen und sich fälschlicherweise davon beeindrucken lassen kann ich abschließend nur einen Hinweis geben: Ein besseres theoretisches Verständnis, eine brauchbarere strategische Perspektive und einen reflektierteren Umgang mit den umkreisten Problemen lässt sich unter der Chiffre „Anarchismus“ finden.