Täterschutz und Supportarbeit
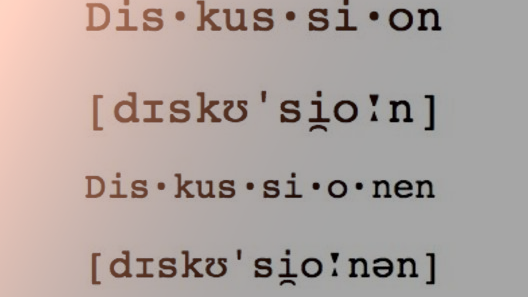
CN: sexualisierte Gewalt, Abuse, Täterschutz
Fälle von patriarchaler Gewalt, die mittlerweile zumindest manchmal durch soziale Netzwerke ein wenig Aufmerksamkeit bekommen, haben für die sie öffentlich machenden Betroffenen meist schwerwiegende Folgen: sowohl das Ausbleiben solidarischer Reaktionen als auch Versuche, die Betroffenen aktiv zu diskreditieren und/oder anzugreifen. Beides schützt den Täter und stärkt seine Position. Der Weg über die Behörden ist, sofern rechtlich überhaupt möglich, nicht nur auf diversen Ebenen anstrengend, er ist auch potentiell retraumatisierend. Somit bleibt am Ende nur die Hoffnung auf ein Verhalten der eigenen Community als Möglichkeit, wenigstens eine Form von Gerechtigkeit zu erhalten. Wenn aber in dieser Szene die solidarischen Reaktionen ausbleiben, zieht das Isolation nach sich, ein Vorgang, auf den wir später noch eingehen werden. Verstärkt wird dieses Problem auch dadurch, dass viele Fälle innerhalb einer Beziehung mit geteiltem Freund*innenkreis passieren. Vor allem dort, im unmittelbaren Umfeld der Betroffenen, ist der fehlende Rückhalt das größte Problem. Es ist also wichtig, Betroffenen beizustehen und solidarische Strukturen aufzubauen.
Dieser Text ist von einer Support-Gruppe und einer Betroffenen geschrieben worden. Er entstand aus der Arbeit mit einem konkreten Fall von Täterschutz. Dabei wurden eigene Erfahrungen reflektiert in der Hoffnung, anderen damit helfen zu können. Zuerst wollen wir verschiedene Formen von Täterschutz aufzeigen. Im Anschluss stellen wir Handlungsmöglichkeiten vor, die beim Aufbau von Support-Strukturen wichtig sein können und werden auf einige konkrete Aspekte eingehen, um mögliche Formen der Organisierung aufzuzeigen. Dieser Beitrag soll aber auch als eine Anregung zur Reflexion gesehen werden. Es ist uns ein Anliegen, dass der feministische Diskurs über die im Text angesprochenen Themen Verbreitung findet.
Disclaimer
Das Wort ‚Täter‘ wird in diesem Text nicht entgendert. Auch FLINTAs können Täter*innen sein. Jedoch geht – und das soll die hier benutzte Schreibweise deutlich machen – patriarchale Gewalt, sei sie physisch oder psychisch, zum Großteil von cis-Männern aus. Das Wort ‚Täter‘ zu entgendern würde diesen Umstand unsichtbar machen.
Täterschutz im Alltag – alltäglicher Täterschutz
Wenn dem sozialen Umfeld eines Täters Täterschutz vorgeworfen wird, stößt das meist auf Unverständnis. Zum einen wird Täterschutz, so der weit verbreitete Glaube, nur da betrieben, wo sich offen mit dem Täter solidarisiert wird und den Betroffenen ihre Erfahrungen abgesprochen werden. Zum anderen ist der eigene Freund*innenkreis doch „mega feministisch“, ganz klar. Er, der Täter, wird somit ganz schnell zum „Missverstandenen“, zum „armen Freund“, der „das alles doch gar nicht so gemeint hat“. Es wird damit aber nicht nur die Tat kleingeredet, sondern auch impliziert, dass die Betroffene „überreagiert“. Das patriarchale Muster, die Lebenserfahrung von FLINTA-Personen zu diskreditieren, indem ihnen gegenüber behauptet wird, sie seien zu „emotional“, ist sehr alt. Noch bis weit ins 20. Jahrhundert galt „Hysterie“ als anerkanntes Krankheitsbild. Damit einher geht das oft schnelle und stille Wiederherstellen eines „Normalzustands“ und das selbstverständliche Einbeziehen des Täters in den freundschaftlichen Alltag. Dadurch wird ein Raum geschaffen, in dem der Täter vor Kritik abgeschirmt wird und in dem sich die Betroffenen dann nicht mehr bewegen können oder wollen.
Supportarbeit hat im Allgemeinen keinen hohen Stellenwert, denn Care-Arbeit ist nicht-männlich konnotiert und bringt somit in der linken Szene auch keine „Street-Credibility“. Sie wird aber nicht nur nicht ernst genommen. Sie ist auch immer, aufgrund der damit untereinander ausgedrückten Solidarität, eine Gefahr für das Patriarchat und wird auch in linken Kontexten fast gänzlich ausgeblendet. Das führt dazu, dass Support-Strukturen nicht einfach entstehen, sondern hart erkämpft werden müssen, während die Strukturen, die den Täter schützen, schon von vornherein existieren, erschaffen durch das Patriarchat.
Übergriffe bleiben von einer breiten Allgemeinheit, sei es die Politgruppe oder der Freund*innenkreis, meist unbemerkt oder werden bewusst ignoriert. Das Formulieren von Vorwürfen aber ist ein öffentlicher Akt, der die vorherrschende Normalität in Frage stellt und nicht übersehen werden kann.
Die Forderung nach einer Positionierung wird oft als unangenehm und den „Szenefrieden“ gefährdend wahrgenommen. So werden Betroffene und Support-Strukturen als „Störfaktoren“ markiert und aufgrund dessen ausgeschlossen, weshalb diese Strukturen auch eher als Angriff und nicht als Verteidigung gewertet werden. Nicht selten ist diese Erfahrung (re-)traumatisierend. Gerade hier ist es wichtig, Solidarität auszudrücken, denn das Schweigen, das „Sich-Raushalten“, bleibt nicht unbemerkt. Im Gegenteil: Für Betroffene ist diese Stille ein unmissverständliches Statement, das lauter nicht sein könnte. Das Ausbleiben von Unterstützung schüchtert ein, lässt verzweifeln und treibt in die soziale Isolation. Hier gilt ganz klar: Wer sich raushält oder „keine Meinung hat“, unterstützt eindeutig den Täter.
Eine Frage der Perspektive
Viele, die im eigenen Freund*innenkreis mit Fällen konfrontiert wurden, werden eins bemerkt haben: Vom Bekanntwerden des Falles bis zu den Wellen der Entsolidarisierung, wichtig scheint vor allem erst mal das Befinden des Täters zu sein.
Oft inszenieren sich diese als die „wahren Opfer“. Sie seien entweder völlig ungerechtfertigt oder aber viel zu harsch angegangen worden und würden nun durch den Call-Out den „sozialen Tod“ erleiden. Es wird betont, wie schlecht es ihnen mit der Situation geht, in die sie sich selbst gebracht haben. Die wenigen Forderungen werden oft als völlig überzogen oder ungerecht empfunden bzw. abgelehnt. Hinzu kommt, dass Schilderungen von Übergriffen vielen Männern klarmachen, dass auch sie sich sexistisch und patriarchal verhalten. Deswegen ist männlicher Täterschutz immer auch Selbstschutz. So wird der Täter dabei unterstützt, sich selber als Underdog darzustellen, der der Institution „Definitionsmacht“ zum Opfer gefallen wäre.
Es wird darauf geachtet, dass der Fokus nie auf der Betroffenen ruht. Diskutiert wird, wie {er} sich fühlt, wie {er} mit der Situation umgeht und ob gestellte Forderungen {ihm} nicht das Leben schwer machen. Denn solange der Täter im Mittelpunkt steht, bleiben die Betroffenen allein und im Hintergrund. Es wird vernachlässigt, wie es ihnen geht und welche Langzeitfolgen die Vorfälle für viele mit sich bringen.
Ist der Fokus nicht mehr auf dem Täter, wird sich stattdessen unermüdlich am Tonfall, in dem die Forderungen oder der Call-Out vorgebracht wurden, abgearbeitet. Immer wieder sind das vor allem weiße cis-Männer, die die linke Szene leider immer noch dominieren und die selbst nur wenigen Unterdrückunsgmechanismen ausgesetzt sind. Deshalb gibt es dort keinen Erfahrungshorizont darüber, welche Wut und vor allem Verzweiflung sich in solchen Situationen bei Betroffenen und den Support-Strukturen entwickeln kann. Häufig sind in diesen Gruppen FLINTAs aktiv, die an dieser Stelle mit der Abwertung von als weiblich assoziierten Attributen und Verhaltensweisen konfrontiert sind. Argumente werden im Zweifelsfall versucht zu delegitimieren, indem sie als zu irrational und emotional bewertet werden.
Ein weiteres Mittel, um Kritik zu delegitimieren, ist der Vorwurf, „Bullenmethoden“ anzuwenden. Gemeint sind teilweise schon Call-Outs über Täter, aber manchmal auch schon das bloße Informieren lokaler Strukturen über patriarchales, sexistisches oder übergriffiges Verhalten von Genossen.
Bei all diesen Formen von Täterschutz wird auf eins peinlich genau geachtet – bloß nicht darüber reden, worum es wirklich geht: um Männerbünde, die sich gegenseitig den Rücken freihalten und die anscheinend oft stärker sind als langjährige Freund*innenschaften; um den grassierenden Sexismus; um die vielen Fälle von sexualisierter Gewalt und anderer physischer Übergriffe; um den psychischen Druck, der gegen nicht cis-männliche Genoss*innen tagtäglich eingesetzt wird, um auf jeden Fall die Oberhand zu behalten.
Das Private ist politisch!?
Doch gibt es auch deutlichere Formen des Täterschutzes. Immer noch nicht ausgestorben ist der Versuch, sexualisierte Gewalt, Übergriffe und patriarchales Verhalten in den Bereich des Privaten zu drängen. So werden Übergriffe als einfache „Streite in der Beziehung“ abgetan, wieso sollte sich da eingemischt werden? Diese Privatebene hilft also, die Vorfälle und Problematiken in den eigenen vier Wänden zu halten, auch weil sie sich dort leichter kontrollieren lassen. Wir müssen aber den strukturellen Charakter hinter sexistischem, patriarchalem und übergriffigem Verhalten erkennen. Wenn es sich bei Übergriffen nicht um ein Politikum handelt, sondern um bloße private Angelegenheiten, wird eine wichtige Ebene übersehen. Probleme sollen verharmlost und relativiert werden. Auch Geschichten aus dem Privatleben der Betroffenen werden nicht selten ausgepackt, um „sich ein Bild zu machen“. Beispielsweise ist dann zu hören, dass Betroffene und Täter doch die ganze Zeit so harmonisch gewirkt hätten und es deswegen bestimmt nicht so schlimm hätte sein können. Spekuliert wird darüber, ob Betroffene vielleicht eifersüchtig seien, Aufmerksamkeit bekommen oder sich einfach nur rächen wollen. Es wird hierbei nicht nur die Gewalt bagatellisiert, sondern auch versucht, der Tat die strukturelle Ebene abzusprechen, die politisch kritisiert werden muss, und so wird aus dem Patriarchat ein „Beziehungsproblem“ und aus Feminismus bloße „Identitätspolitik“.
Die traurige Tatsache, dass die Supporter*innengruppe immer aus dem eigenen engen Umfeld der betroffenen Person heraus entsteht, bedeutet also im Umkehrschluss: Alle, die kein breites soziales Umfeld haben, bekommen auch keinerlei Unterstützung und sind meist auf sich allein gestellt.
Das Patriarchat „in den eigenen vier Wänden zu lassen“, bedeutet auch, den Austausch unter Betroffenen zu erschweren. Denn wenn diese Themen nur im Privaten ausgehandelt werden, könnte schnell der Eindruck entstehen, dass es sich um persönliche Probleme oder Einzelfälle handele. Dadurch können bei den Betroffenen selbst Zweifel an der strukturellen Dimension des Geschehenen gesät werden. Doch wenn Erfahrungen verglichen werden, zeigen sich schnell dieselben zu Grunde liegenden Muster.
Die Folgen des Täterschutzes
Täterschutz hilft nicht nur dem einzelnen Täter dabei, sein Leben normal und unreflektiert weiterzuleben, sondern erschafft durch das Ermutigen von Tätern auch ein Umfeld, in dem Taten überhaupt erst begangen werden können. Er ermöglicht und verstärkt Sexismus und ist so ein fundamentaler Bestandteil des Patriarchats. Bei den Betroffenen kann Täterschutz einerseits zu aktiver sozialer Isolation führen, zum Verlust des Freund*innenkreises und der Gefangenschaft in den eigenen vier Wänden, da der Täter weiterhin in der bekannten Kneipe abhängen oder auf Demos in der ersten Reihe stehen kann. Täterschutz kann aber auch zu passiver Isolation führen, einer Atmosphäre aus Angst und dem Allein-gelassen-Werden – dem Verstehen, dass die besten Freund*innen doch nicht so solidarisch sind und mensch im schlimmsten Fall ganz allein dasteht. Täterschutz als Mittel des Patriarchats, um keine Kritik aufkommen zu lassen, darf nicht unterschätzt werden. Viele nicht cis-männliche Menschen müssen lernen, täglich mit patriarchalen Angriffen umzugehen. Doch diesen dann im eigenen Freund*innenkreis entgegenzustehen, ist um einiges schwerer.
Der Täter wird geschützt! Was nun?
Während sich die Strukturen, die sich schützend vor Täter stellen, häufig nicht organisieren müssen, sondern organisch im Alltag entstehen bzw. vom Patriarchat geliefert werden, kann das für Support-Strukturen leider nicht gesagt werden. In dem folgenden Abschnitt soll es daher darum gehen, wie solche Unterstützer*innengruppen aufgebaut werden können, was unserer Meinung nach deren Aufgaben sein sollten und worauf geachtet werden muss.
Es ist wichtig, sich für diesen Weg selbst einschätzen zu können: Wie viel kann ich selbst aushalten und mit wie viel Belastung kann ich umgehen? Kann ich einen Teil der Aufgaben übernehmen und gewissenhaft erledigen oder werde ich zu wütend, bin ich zu sehr involviert und geht es auf einmal doch mehr um mein persönliches Empfinden? Wichtig ist: Auch wenn ihr merkt, dass ihr gerade nicht belastbar seid, zeigt, dass ihr den Betroffenen gegenüber solidarisch seid. Durchbrecht die Isolation, in der viele Betroffene stecken. Seid für einander da! Auch kleine Gesten können schon einen großen Unterschied machen. Solltet ihr euch nicht sicher sein, ob es schon eine Gruppe gibt, könnt ihr erst mal im näheren Kreis nachfragen. Wenn auffällt, dass noch keine Support-Strukturen vorhanden sind, schreibt die Betroffenen an. Bedenkt dabei, dass Betroffene sich meistens in großem Stress befinden. Es besteht die Gefahr, dass ihr mit eurer zwar gut gemeinten Nachricht zur Überforderung von Betroffenen beitragt. Also weist am Anfang eurer Nachricht mit einer Content-Warnung darauf hin, dass ihr dieses Thema ansprechen werdet. So kann die betroffene Person selbst entscheiden, wann sie sich mit diesem Thema auseinander setzen will. Nach der Content-Warnung sollte zuerst festgestellt werden, dass ihr uneingeschränkt solidarisch mit der Betroffenen seid. Fragt dann nach, ob und wie ihr gerade helfen könnt. Zum Schluss ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es auch ok ist, wenn die Betroffene nicht oder erst spät reagiert, so nehmt ihr den Druck aus der Unterhaltung.
Aufgaben einer Supporter*innengruppe
Grundlegend kann gesagt werden, dass das Hauptaugenmerk der Unterstützer*innengruppe auf dem Empowering der Betroffenen liegen sollte. Wichtig ist, einen Raum zu schaffen, in dem Betroffenen zugehört wird und in dem Forderungen formuliert werden können. Es muss dabei nicht um einen genauen Umgang mit dem Täter gehen, Forderungen können auch lediglich einen Ausschluss des Täters aus politischen Projekten oder das bloße Informieren des Täterumfeldes beinhalten. Druck sollte bei diesem Prozess nicht aufkommen. Weder muss die Betroffene erklären, was genau passiert ist, noch muss umgehend ein detaillierter Forderungskatalog aufgestellt werden. Die Auseinandersetzung mit Übergriffen wird einiges an Zeit beanspruchen und so kann es sein, dass am Anfang keine Forderungen aufgestellt werden und das Empowering Vorrang hat. Auch sollte innerhalb der Gruppe das soziale Einbinden der Betroffenen ein Thema sein, da sie, wie bereits erwähnt, von sozialem Ausschluss bedroht sein kann.
In den folgenden Abschnitten wird es um die Organisierung der Gruppe gehen.
Die Kommunikation
Wenn sich eine Gruppe von Leuten gefunden hat, sollte zunächst über die interne Kommunikation gesprochen werden. Hier ist es sinnvoll, zwei voneinander getrennte Kommunikationswege zu etablieren. Einen, der Betroffene einschließt, und einen, in dem sich die Supporter*innengruppe separat organisieren kann. Diese Zweiteilung ist nötig, da aufkommende Differenzen innerhalb der Gruppe nicht mit Betroffenen besprochen werden sollten, da sonst die Gruppe nur zu einer weiteren Belastung wird. Auch sollten hier Supporter*innen füreinander da sein, da diese Arbeit manchmal belastend werden kann.
Wenn die interne Kommunikation steht, sollte sich darüber ausgetauscht werden, wie die Kommunikation nach außen organisiert wird. Sinnvoll ist es, eine E-Mail-Adresse einzurichten und gleichzeitig deutlich zu machen, dass diese der einzig korrekte Weg ist, mit der Gruppe Kontakt aufzunehmen. Der Vorteil einer eigenen E-Mail-Adresse ist, dass sich die Gruppen und Menschen, die mit euch in Kontakt treten wollen, genau überlegen müssen, wie sie ihre Nachricht formulieren, und die Kommunikation nachvollziehbarer und für die Gruppe insgesamt transparenter wird. Die Auseinandersetzung mit solchen E-Mails kann aber einiges an Zeit und Kraft kosten. Auch deswegen ist eine E-Mail-Adresse sinnvoll, denn so kann bewusst entschieden werden, ob mensch in der Lage ist, mit derartigen Nachrichten konfrontiert zu werden. Sollte es auf der Straße bzw. im Alltag dazu kommen, dass es direkte Fragen zu dem Thema gibt, sollten diese nur mit dem Nennen der E-Mail-Adresse und dem Hinweis, dass sich an diese gewandt werden kann, beantwortet werden. Erklärungen oder Statements sollten in derartigen Situationen nicht abgegeben werden, da es in stressigen Momenten, wie zum Beispiel auf Demos, häufig Missverständnisse gibt. Bei der Beantwortung von E-Mails hingegen kann der Ausdruck genau bedacht werden. Sollte es von Betroffenen gewünscht sein, muss auch Kontakt zum Täter hergestellt werden. Hierfür ist es wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass zum Schutz des Täters gerne eher darauf eingegangen wird, wie Kritik formuliert wurde. Während der Gespräche mit dem Täter muss der Tonfall also ruhig, aber entschlossen sein. Beleidigungen, so verständlich diese auch immer sein mögen, dürfen nicht durch den Raum geworfen werden. Diese helfen ausschließlich der Gegenseite. Denkt immer daran, warum ihr gerade die Kommunikation aufgenommen habt. Hier geht es nicht darum, wie ihr eine Situation einschätzt, sondern was den Betroffenen am meisten hilft.
Seid euch auch immer bewusst, dass ihr unter Umständen sehr persönliche Daten in den Händen haltet, die nicht an die Falschen geraten dürfen. Denkt an Verschlüsselung, automatisches oder manuelles Löschen von Kommunikationen und Kontakten und bietet verschlüsselte und anonyme Kontaktwege nach außen an. Das kostet zusätzliche Energie, ist aber wichtig.
Call-Out
Leider ist das immer noch ein „kontroverses“ Thema. Würde das Thema Täterschutz auch nur mit halb so viel Elan diskutiert werden wie Call-Outs gegen Sexisten, würden wir jetzt wohl schon ganz wo anders stehen. Wir finden, dass Call-Outs, also das Öffentlichmachen von Tätern und deren Verhalten, eine legitime und oft auch absolut notwendige Antwort auf patriarchale Gewalt darstellen. Durch Call-Outs wird Öffentlichkeit hergestellt, die nicht nur dafür sorgt, dass über den Fall geredet wird, sondern auch zu Solidarität führen und empowernd auf andere Betroffene wirken kann. Außerdem erzeugen Call-Outs den Zwang, sich zu verhalten, was ohne diesen Druck sonst sicherlich kaum stattfinden würde. Solidarität Betroffenen gegenüber zu zeigen, ist essentiell in solchen Situationen, denn wie schon festgestellt, ein „Sich-nicht-Positionieren“ hilft ausschließlich dem Täter.
Call-Outs können sehr unterschiedlich aussehen. Sie müssen keinen genauen „Tathergang“ beinhalten, um ernst genommen zu werden. Es kann auch grob umschrieben werden, worum es geht und warum dieser Schritt notwendig war. Wichtig ist natürlich, was sich die Gruppe von dem Call-Out erhofft, und somit mögliche Forderungen. Sollte die Betroffene keine formuliert haben, genügt die Aufforderung, sich bzgl. des Vorfalls zu verhalten und Solidarität zu zeigen. Zum Schluss sollten immer die E-Mail-Adresse der Unterstützer*innengruppe und der Hinweis stehen, dass nur über diese kommuniziert wird. Selbstverständlich sollten Name und andere persönliche Informationen von Betroffenen nicht erwähnt werden. Lasst den Text wenigstens einen Tag liegen und lest dann noch mal drüber. So gewinnt ihr ein wenig Abstand und könnt an Formulierungen noch etwas feilen.
Nachdem der Text steht, sollte darüber nachgedacht werden, wo dieser veröffentlicht wird. Es kann sinnvoll sein, diesen nicht ins Internet zu stellen, sondern nur an lokale Projekte zu schicken oder ihn dort selbst vorzulesen. Das Selbst-Vorlesen kann den Vorteil haben, dass der Call-Out nicht untergehen kann und definitiv gehört wird. Auch hier ist wichtig, darauf zu bestehen, dass Nachfragen nur über die E-Mail-Adresse beantwortet werden. Sollte sich aber dazu entschieden werden, den Text überregional zu veröffentlichen, ist mitzudenken, dass Cops und Nazis mitlesen können. Auf die Szene betreffende Informationen sollte hier verzichtet werden. Gerade was Indymedia betrifft, muss mit einer Welle an negativen Kommentaren gerechnet werden. Es sollte sich also schon im Vorfeld überlegt werden, wie mit diesem zusätzlichen Stress umgegangen werden kann. Wichtig ist, dass bei all diesen Prozessen die Betroffenen das letzte Wort haben. Es muss darum gehen, womit sich die Betroffenen wohl fühlen und nicht darum, was die Gruppe am sinnvollsten findet. Generell muss auch beachtet werden, dass Call-Outs die Kommunikation mit dem Täter negativ beeinträchtigen können. Es ist also abzuwägen, wie im Einzelfall gehandelt werden sollte. Klar ist, dass ihr auch unschöne Antworten erhalten könnt. Geht vorher darauf ein, wie ihr damit umgehen wollt.
Wann sind Call-Outs überhaupt gerechtfertigt? Wie lange müssen sich Betroffene mit Tätern und Täterschützern auseinandersetzen, bis öffentlich über Vorfälle geredet werden darf? Wir finden, dass dabei keine bestimmte Zeitspanne eingehalten werden muss, ein Call-Out ist legitim, wann auch immer die betroffene Person sich dazu entscheidet.

